Dilek Güngör: „Vater und ich“

Für ein verlängertes Wochenende fährt Ipek zu ihrem Vater. Sie lebt eigentlich in Berlin, arbeitet dort als Journalistin. Doch als ihre Mutter zu einem Wellnessurlaub mit ihren Freundinnen aufbricht, beschließt sie, einige Tage mit ihrem Vater zu verbringen. Sie erinnert sich an und sehnt sich nach der engen Bindung, die es einst zwischen ihnen beiden gab und die sich schleichend löste. „Zwischen uns herrscht eine Wortlosigkeit, dass mir eng wird in der Brust.“ Wie eine unsichtbare Mauer steht Unausgesprochenes, stehen Missverständnisse und Verletzungen zwischen ihnen. Diese Sprachlosigkeit hat viele Gründe.
Die Eltern, einst der Perspektivlosigkeit in der Türkei entflohen, haben sich in Deutschland als Näherin und Polsterer ein bescheidenes Leben aufgebaut. Ipek lernt früh, mit Zurückweisungen und Beleidigungen im Umfeld umzugehen. „Geschwiegen haben wir und weggehört, die anderen haben geredet. Meinten wir, unser Schweigen könnte uns beschützen, das Böse würde einfach an uns abprallen, wenn wir nur den Mund geschlossen hielten?“
Ipek schafft es aufs Gymnasium, lässt ihr Milieu und die Sprache ihrer Eltern hinter sich, studiert, wird Journalistin – und entfernt sich immer mehr von ihrem Vater. Das verlängerte Wochenende, so hofft sie, könnte sie einander wieder näherbringen. Doch es ist ein schwieriges Unterfangen. „Überall fehlen mir die Worte, in deiner Sprache, in meiner Sprache und mit dir sowieso.” Nur im gemeinsamen Tun finden Ipek und ihr Vater einen gemeinsamen Rhythmus, eine Vertrautheit jenseits der Worte.
Die Erzählerin spürt der Entfremdung mit großer Offenheit nach, findet eine schnörkellose, geradlinige Sprache für die Sprachlosigkeit zwischen den beiden. Ein schmales, aber ungeheuer gehaltvolles Buch um die Fragen nach Identität, Heimat und Herkunft – nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021.
Dilek Güngör: Vater und ich. Roman. Verbrecher Verlag 2021
Tipp von Susanne Gurschler
Ö1-Moderator Günter Kaindlstorfer diskutiert Joe Rabl (Lektor), Gabriele Wild (Literaturvermittlerin) und Erika Wimmer (Schriftstellerin) über folgende Bücher:
Daniel Kehlmann: Tyll. Roman. Rowohlt Verlag
Gertraud Klemm: Erbsenzählen. Roman. Droschl Verlag
Édouard Louis: Im Herzen der Gewalt. Roman. Fischer Verlag
Mütter dieser Welt, vereinigt euch!
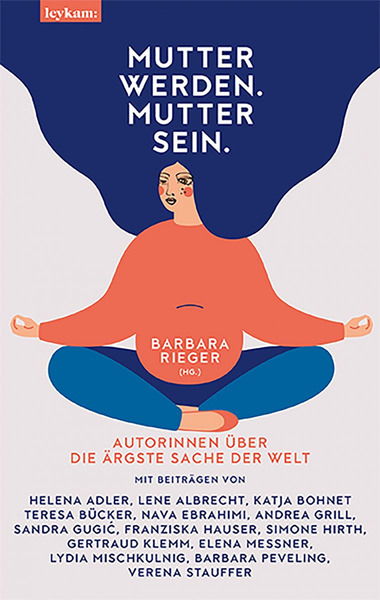
In der von Barbara Rieger herausgegebenen Anthologie Mutter werden. Mutter sein. erschienen im Leykam Verlag, erzählen 15 Autorinnen von der – wie es im Untertitel heißt – „ärgsten Sache der Welt“ und legen damit nicht nur einen literarischen, sondern auch einen gesellschaftspolitisch starken Auftritt hin.
Als Nava Ebrahimi im heurigen Jahr der Bachmannpreis verliehen wurde, saß sie pandemiebedingt zuhause vor einem Bildschirm. Über den Livestream zu sehen war lediglich ihr Gesicht, dahinter eine weiße Wand. Später jedoch tauchte auf Twitter und infolge auch in der Tageszeitung Der Standard ein Foto auf, das einen Blick in das Zimmer, in dem die Autorin im Moment der Verleihung saß, preisgab. Das Foto zeigt die Autorin auf ihrem Schreitisch sitzend, umringt von Spielzeug: Legosteine, eine Ritterburg mit Wassergraben, Matchboxautos und Puzzleteile waren auf dem Parkettboden des Zimmers verteilt.
Die ausgezeichnete Autorin wurde durch dieses Foto plötzlich auch als Mutter sichtbar. Da saß sie also die schreibende Mutter, in einem Zimmer, das also keines für „sich allein“ war, wie es Virginia Woolf empfahl, sondern eines, das scheinbar von den Kindern mit ihren Legorittern längst okkupiert worden war. Nava Ebrahimi ist eine der 15 Autorinnen, die von Herausgeberin Barbara Rieger eingeladen wurde, einen Text über ihre Mutterschaft beizutragen. „Ich wünsche mir“, schreibt Ebrahimi in ihrer Auseinandersetzung, die sie an einem „heißen Sonntag“ im „abgedunkelten Wohnzimmer“ in den Computer tippte, während ihr Mann mit den Kindern im Freibad ist, „dass ich diese Seite meines Lebens nicht mehr ausblenden muss, um als Schriftstellerin weiterhin ernst genommen zu werden.“ Damit trifft sie den springenden Punkt, denn tatsächlich „verheimlichen“ viele Schriftstellerinnen ihr Dasein als Mütter, um im Literaturbetrieb neben ihren männlichen Kollegen gleichwertig bestehen zu können.Die ausgezeichnete Autorin wurde durch dieses Foto plötzlich auch als Mutter sichtbar. Da saß sie also die schreibende Mutter, in einem Zimmer, das also keines für „sich allein“ war, wie es Virginia Woolf empfahl, sondern eines, das scheinbar von den Kindern mit ihren Legorittern längst okkupiert worden war.
Insofern liefert die – im ambitionierten Literaturprogramm des Leykam Verlags – erschienene Anthologie einen wesentlichen Diskussionsbeitrag zur Sichtbarmachung der Lebens- und Arbeitswelten von Care-Arbeit leistenden Schriftstellerinnen. Die Textsammlung korrespondiert dabei wohl auch nicht zufällig mit dem Kollektiv writing with care/rage, einer Gruppe schreibender Mütter, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Literaturbetrieb mit Forderungen nach faireren Arbeitsbedingungen zu konfrontieren. Vertreterinnen des Kollektivs, wie z.B. Sandra Gugić oder Lene Albrecht sind auch in der Anthologie zu finden.
Das Besondere an der Textsammlung ist aber nicht ausschließlich der Signal setzende, gesellschaftspolitische Aspekt, es sind vor allem auch die unterschiedlichen literarischen Herangehensweisen der Autorinnen: Katja Bohnet beispielsweise schreibt über eine Mutter-Tochter Beziehung in Form der skurrilen Geschichte Meine Mutter, die Serienmörderin, Teresa Bücker denkt darüber nach, ob es radikal sei ohne Partner ein Kind zu bekommen, Lene Albrecht verhandelt in ihrer Erzählung Eine gute Frau, den Fall einer jungen Mutter, die eine Putzfrau ohne Sozialversicherung engagiert und – trotz guter Absichten – erkennen muss, dass sie selbst Teil eines ausbeuterischen Systems ist. Sandra Gugić beschreibt in ihrer Reflexion Blut, Milch, Digitale Tinte eindringlich, wie sich ihre Art zu Schreiben (und zu Denken) durch die Geburt ihres Kindes verändert hat und was das für sie als Autorin bedeutet. „Es wird eine der großen Ideen des 21. Jahrhunderts sein, dass Mütter Schriftstellerinnen sind und umgekehrt“, schreibt Elena Messner ironisch in ihrem Brief an eine muttergewordene Schriftstellerin und Simone Hirth verfasst mit Wir wollen was ein flammendes Manifest, das die gemeinsame Kraft der Mütter dieser Welt hochleben lässt.
Mutter werden. Mutter sein ist vor allem auch ein Buch über Frauensolidarität und weibliche Wahlverwandtschaften, die durch die Kraft des gesammelten Auftritts spürbar werden. Ein inspirierendes Buch, in dem darüber hinaus erfrischende Gegenpositionen zum (wohl ohnehin schon längst überholten) Begriff des (männlichen) künstlerischen Genies deutlich werden. Empfehlenswert!
Barbara Rieger (Hg.): Mutter werden. Mutter sein. Leykam: Belletristik 2021.
Tipp von Gabriele Wild
in Zusammenarbeit mit Silke Dürnberger und Mona Müry
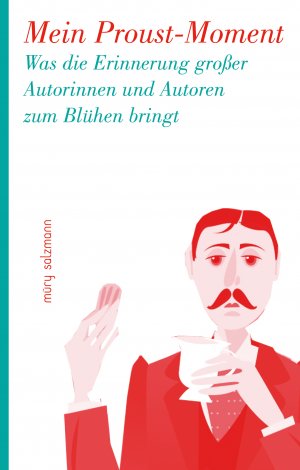
Im Sommer nach meiner Matura wohnte ich bei der Gräfin Anne de Martel in der Rue Jean de la Fontaine im 16. Pariser Arrondissement. Ich war Au-pair-Mädchen in der Familie ihres Sohnes, lieh der alten Gräfin allmorgendlich mein höfliches Ohr, wenn sie von den jüngsten Ereignissen im Umfeld des von ihr verehrten Papstes Johannes-Paul II. berichtete, sagte „Bonjour, Madame“, „Au-revoir, Madame“, „Merci, Madame“ und sprach mit ihr nicht von den kommunistischen Intellektuellen, wie es mir ihre Schwiegertochter ans Herz gelegt hatte. Eines Tages kaufte ich in einer Pâtisserie am Marché Saint-Germain Makronen, deren unwirklicher Preis mir ein länger andauerndes Bauchkribbeln bescherte – und in meiner Erinnerung eine erste Begegnung mit Marcel Proust. Bei der späteren gemeinsamen Nachmittagsjause rief die Gräfin nämlich erfreut „Ah! Dorissse, des macarons de chez Gérard Mulot“ und fügte, noch bevor sie kostete, hinzu „Ah! quelle madeleine de Proust“. Madeleine war natürlich ein französischer Mädchenname. Oder auch ein Rührteigbiskuit in Muschelform, wie ich seit Kurzem wusste. Aber was in aller Welt bedeutete „proust“? Ich konnte die Gräfin nicht fragen, denn sie sprach bereits von einer anderen Zeit, verlor sich in Erinnerungen an die glücklichen ersten Jahre ihrer Ehe. Und so sollte für mich die Bedeutung von Proust noch fast ein Jahr lang im Dunkeln bleiben.
Den von Anton Thuswalder in Zusammenarbeit mit Silke Dürenberger und Mona Müry in Mein Proust-Moment versammelten Madeleine-Erlebnissen und Reflexionen (von Martin Walser, Bernd-Jürgen Fischer, Alexander Kluge, Anna Baar, Jens Wonneberger, Anna Kim, Christina Maria Landerl, Julya Rabinowich, Peter Kümmel, Eleonora Hummel, Daniel Wisser, Reinhard Stöckel, Elke Laznia und Josef Winkler) verdanke ich nicht nur die Wiederbelebung meiner ins Vergessen entschwundenen ersten Schokolademakronenerfahrung, sondern auch einen der unvergesslichsten Lektüremomente dieses Herbstes. Entlang begehrlicher Gerüche und trauriger Düfte, berauschender Aromen und unverwechselbarer Konsistenzen, tödlicher Klänge, Wermutkraut oder einer„Kombination aus Gras-Noten, einer Spur Säure und einem Hauch Vanille“ (99) – so beschrieben nach Reinhard Stöckel englische Wissenschaftler den muffigen Geruch alter Bücher – entfalten die von den Autor*innen so meisterhaft erzählten Einblicke in längst vergangene Sinneserfahrungen einen Zauber, dem man sich so einfach nicht entziehen kann und schon gar nicht will. Retrotopische Augenblicke des Banalen – von Martin Walser in seinem Text als „unscheinbare Situationen des Alltags“ bezeichnet und für ebenso wichtig erachtet „wie irgendeine Festwoche voller Metaphysik“ (15) –, die in ihrer sprachlichen Präzision und Schönheit Proust alle Ehre machen und uns daran erinnern, dass gerade in Zeiten wie den unseren „[d]as Lesen […] wie das Atmen eine essentielle Lebensfunktion“ ist (so Alberto Manguel in Eine Geschichte des Lesens).
Am Ende des Buches sind die Leser*innen aufgefordert, den Proust-Momenten der großen Autorinnen und Autoren auf dafür vorgesehenen leeren Seiten ein persönliches „unmittelbare[s], köstliche[s], alles erfassende[s] Aufzucken der Erinnerung“ (Die wiedergefundene Zeit) hinzuzufügen. Eine wunderbare Einladung, der man gerne folgt.
Anton Thuswalder (Hrsg.), Mein Proust-Moment. Was die Erinnerung großer Autorinnen und Autoren zum Blühen bringt, in Zusammenarbeit mit Silke Dürnberger und Mona Müry, Salzburg/Wien: müry salzmann, 2021.
Tipp von Doris Eibl
Die Anthologie Mein Proust Moment hätte, am 7. Dezember im Literaturhaus am Inn präsentiert werden sollen. Stattdessen „nur“ die Lese-Empfehlung.
Neuer Präsentationstermin ist Mittwoch, der 9. Februar – save the date!

In Johanna kommt die titelgebende Jungfrau nicht vor, zumindest nicht als Figur, in Hoppe imaginiert sich die Autorin selbst eine fantastische Autobiographie herbei. Weihnachten verlegt sie in Paradiese, Übersee nach Indien und in ihrem Roman über ihre Weltreise auf einem Containerschiff nimmt sie kurzerhand Antonio Pigafetta mit an Bord. Prawda hingegen, benannt nach der sowjetischen Zeitung, ist ein Roadtrip durch – wie könnte es anders sein – die USA. Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass Felicitas Hoppe in ihrem neuen Roman Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm nicht einfach nur den alten Sagenstoff in neuem Gewande präsentiert. Das deutsche Nationalepos wird vermischt mit einer Aufführung in der Nibelungenstadt Worms, im Hintergrund läuft dezent Fritz Langs Stummfilm von 1924 mit. Irgendwann gibt man auf, trennen zu wollen, was hier zur Sage gehört und was zur Inszenierung, wer Figur ist und wer Schauspieler, was Wahrheit und was Erzählung, immerhin lautet das Motto der Büchnerpreisträgerin Hoppe: „Es ist nichts erlogen, ich habe alles ehrlich erfunden.“ Der wahre Star des Hoppe’schen Erzähluniversums ist ohnehin ihre Sprache, die poetisch mit viel Witz neue Zusammenhänge herstellt und einen zwingt, eingefahrene Denkmuster aufzugeben. Mehr kann gute Literatur nicht leisten.
Felicitas Hoppe: Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm. Roman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2021
Tipp von Veronika Schuchter
Texte, so gleißend hell wie das Licht Floridas, so dunkel, wild und unberechenbar wie dessen Sümpfe.

In ihrem Erzählband Florida beweist die 1978 geborene Autorin Lauren Groff auf beeindruckende Weise, wie das zeitgenössische Erzählen von einer Welt, in der sich der Klimawandel gerade vollzieht, gehen kann. Die Leser*innen begegnen in den Erzählungen einer Vielzahl meist weiblicher Protagonisten, und was diese erleben, in welcher Situation sie sich befinden – das ist durchaus irritierend bis verstörend. So werden zwei Mädchen allein in der Wildnis zurückgelassen, eine Mutter läuft jede Nacht gegen ihre Wut und ihre Zweifel an, eine weitere gibt, einem inneren Impuls folgend, alles auf, was sie hat. Eine weitere befindet sich „Auge in Auge“, so der Titel der Erzählung, mit dem Hurrikan, der über ihr Haus hinwegfegt und sie auf dessen Trümmern wie auch auf jenen ihres Lebens zurücklässt.
Es sind allesamt Ausnahmeentscheidungen, Ausnahmezustände, die noch verstärkt werden, als sie in Ausnahme-Wetterzuständen stattfinden, in der ständig sich steigernde flirrende Hitze Floridas, während eines Hurrikans, eines Dauerregens und dem darauf folgenden Hochwasser. Neue Schrecken, deren Dimensionen den Menschen in ihren Erzählungen noch nicht bewusst sind, und denen sie hilflos ausgeliefert scheinen, obwohl sie deren Verursacher sind.
Lauren Groff: Florida. Erzählungen. Hanser Verlag 2019
Tipp von Anna Rottensteiner
Barbi Marković: Die verschissene Zeit. Roman. Residenz 2021
Ágnes Czingulszki: Mutterhunger. Unveröffentlichtes Manuskript
Die legendäre Lesereihe Grenzgänge, veranstaltet vom Verein 8ung Kultur übersiedelt in das Literaturhaus am Inn: Mit Barbi Marković und Agnés Czingulszki sind dieses Mal zwei Autorinnen zu Gast, deren Schreiben eine außergewöhnliche Doppelbödigkeit auszeichnet: leicht, witzig und frech an der Oberfläche, intelligent und subtil in der Tiefe.
Barbi Marković präsentiert den Roman Die verschissene Zeit (Residenz 2021), ein popkulturelles Spiel mit dem Belgrad der 1990er Jahre.Ágnes Czingulszki liest am Abend aus ihrem unveröffentlichten Manuskript Mutterhunger lesen, einem teils autobiographischen Roman, in dem eine junge Frau sich in Folge einer Krise mit der Auswanderungsgeschichte ihrer Familie auseinandersetzt.
Wichtig:
Wir können leider nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen mit sicherem Abstand zu einander anbieten. Gerne reservieren wir für Sie einen Platz, hierfür bitte unter literaturhaus@uibk.ac.at anmelden.
Bis 12:00 Uhr des Veranstaltungstages können wir die Anmeldungen bestätigen. Kurzentschlossene sind herzlich willkommen, wir bitten aber um Verständnis, sollten Sie aufgrund der Besucherbeschränkung keinen Platz mehr bekommen.
Brita Steinwendtner: Gesicht im blinden Spiegel. Roman. Otto Müller Verlag 2020
Angesiedelt in der Zeit zwischen 1866 und 1915 erzählt Brita Steinwendtner in ihrem atmosphärisch dichten Roman Gesicht im blinden Spiegel (Otto Müller Verlag) das Schicksal von Johannes, dem es gelingt, den widrigen Zeitläufen die Stirn zu bieten und seine pazifistische Haltung zu wahren.
Das weit gespannte Panorama einer fesselnden Familien- und Zeitgeschichte über mehrere Jahrzehnte führt vom „Böhmischen Paradies“ über das Sensengebiet des österreichischen Steyr-Tals bis in das „weiße Haus“ von Venedig. Eine vielstimmig erzählte Geschichte von Krieg und trügerischem Frieden, neuen Lebensentwürfen in der Fremde und vom Heimkommen.
Stephan Roiss: Triceratops. Roman. Kremayr & Scheriau 2020
Angela Lehner: 2001. Roman. Hanser Berlin 2021
Zu Gast sind zwei originelle Stimmen der jungen deutschsprachigen Literatur.
In harten Schnitten und bildhaften Szenen erzählt Stephan Roiss die Geschichte seines namenlosen Protagonisten, der in einer toxischen Umgebung aus biederer Frömmigkeit, Esoterik und psychischer Labilität aufwächst und dem Trauma einer und der Einsamkeit zu entfliehen versucht.
In ihrem neuem Roman 2001 erzählt Angela Lehner vom Aufwachsen im Tal, von Perspektivenlosigkeit und familiärer Vernachlässigung und schafft mit ihrem unverwechselbaren Sound einen großen Roman, der nicht zuletzt von Freundschaft erzählt.
Wie lassen sich künstlerische Arbeit und Sorgearbeit vereinbaren? Eine Gruppe schreibender und „wütender“ Mütter schloss sich in diesem Frühjahr unter dem Namen „Writing with CARE/RAGE“ zu einem Kollektiv zusammen, um u.a. auf die fehlende Gleichberechtigung von Sorgearbeitenden im Literaturbetrieb aufmerksam zu machen: Schreiben Care-Arbeiterinnen anders? Ist das viel zitierte „Zimmer für sich allein“ Voraussetzung für das Schreiben? Wie wird eine Autorin, die auch Mutter ist, im Literaturbetrieb wahrgenommen? Inwiefern ist es heute notwendig, neue künstlerische Formen zu entwickeln, um Unsichtbares, wie Sorge- und Pflegearbeit, sichtbar zu machen? Am Abend diskutieren die in Berlin lebende Tirolerin Elisabeth R. Hager als Stimme des Kollektivs und die, für ihr politisches Schreiben bekannte und in Berlin lebende, Südtiroler Autorin Maxi Obexer über Frauensolidarität, politische Forderungen und künstlerische Arbeit u.a. in Zeiten der Coronakrise.
>>> Hier geht's zum Livestream
Am 10. und 11. November 2021 findet die Hybridtagung „Systemrelevant? Literatur und Arbeit in der Coronakrise“ statt.
Informationen zur Veranstaltung und das Programm
Organisation: Dr. Alena Heinritz (Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft, Universität Innsbruck)
Veranstaltungsort: Claudia-Saal (Claudiana, Herzog-Friedrich-Straße 3, 6020 Innsbruck) und virtuell (die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail – schreiben Sie dazu bitte an alena.heinritz@uibk.ac.at)“








